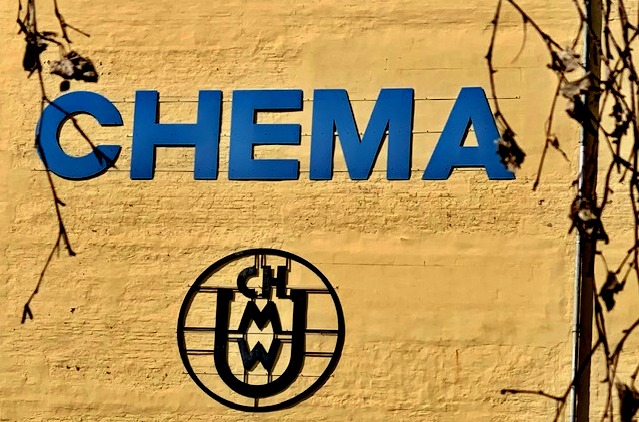Am 9. November 1989 fiel die Mauer. Das war ein historischer Einschnitt, der das Leben jedes Einzelnen veränderte. Zum Positiven, hofften damals die meisten. Betrachtet man die Gegenwart in der Region Arnstadt, scheint das hier gelungen zu sein. Die Wirtschaft entwickelt sich gut, die Arbeitslosigkeit ist gering, Arnstadt wächst und wird jünger. Doch nach dem Mauerfall sah es zunächst ganz anders aus.
Der Wiedervereinigung folgte ein Jahrzehnt, das vor allem von Deindustrialisierung und Verlust von Perspektiven gekennzeichnet war. Viele Tausende verloren ihre Arbeit, manche von Ihnen haben nie wieder ins „normale“ Leben zurückgefunden. Das hat bis heute Auswirkungen auf die Stimmung in der Region.
Beispielhaft soll hier die Entwicklung von vier Betrieben beschrieben werden, die in der DDR weit über die Region hinaus bekannt waren: Chema, Nadelwerk, Wellpappe und RFT.
Rühren, Mischen, Eindampfen: die Chema
Als die Wende kam, hatte die „Chema“ ihren 50. Geburtstag gerade hinter sich. Er war nicht gefeiert worden, denn auf die Anfänge als Rüstungsbetrieb schaute niemand gern zurück.
Auf dem Gelände einer kleinen chemischen Fabrik in Rudisleben und zwei Nachbargrundstücken hatte der Unternehmer Max Kotzan 1938 seine Firma „MAKO“ errichtet. Kotzan war im ersten Weltkrieg Kampfflieger gewesen, genau wie Hermann Göring. Die offenbar noch immer engen Beziehungen zur Nazi-Größe nutzte er, um seine Produktion auf das einzustellen, was 1938 gebraucht wurde: Rüstung. Unter anderem wurden Sauerstofftanks und -abfüllanlagen für Raketen sowie Abwurfbehälter für die Luftwaffe hergestellt, dazu beschäftigte Kotzan zunehmend auch Zwangsarbeiter aus vielen Ländern Europas.
Nach dem Krieg war der Betrieb sieben Jahre lang unter sowjetischer Verwaltung, bevor 1954 die „Chemischen Maschinenbauwerke“ als Volkseigener Betrieb weitergeführt wurden. Die „Chema“ produzierte spezielle Apparate und große Anlagen, das Spektrum reichte von Meerwasserentsalzungsanlagen für Schiffe und ganzen Brauereien (in Kuba wurde 1985 eine der größten Brauereien Mittel- und Südamerikas errichtet) über Rührkessel und Fermentoren für die PVC-Herstellung bis hin zu Milcheindampfanlagen. Immer wieder gab es spektakuläre Großaufträge, die die „Chema“ allein realisierte oder mit Partnern: Die Sektkellerei „Rotkäppchen“ zum Beispiel, komplette Produktionsanlagen in Schwarza und Guben, Jugoslawien, Rumänien und Bulgarien, einige davon sind noch heute in Betrieb. 1964/65 entstand das spätere Wahrzeichen der Chema: Ein Bürogebäude direkt an der Ichtershäuser Straße in Stahlbeton-Skelettbauweise mit durchgehender Glasvorhangfassade, das für damalige Verhältnisse fast futuristisch anmutete.

Auf vielen Gebieten war die Chema führend in den sozialistischen Ländern, in einigen Fällen sogar weltweit. Das Motto lautete: Rühren, Mischen, Eindampfen. Dass sie das besonders gut konnten, wussten die Mitarbeiter auch, der Betriebsstolz war in der „Chema“ besonders stark ausgebildet.
1989 waren in der Chema 2200 Menschen beschäftigt, einschließlich etwa 150 Vertragsarbeiter aus Vietnam und Kuba. Dass der Übergang in die Marktwirtschaft nicht leicht werden würde, machte der damalige Betriebsdirektor Günter Kilx in einer Mitteilung an alle Belegschaftsangehörigen im Mai 1990 deutlich. Er zeigte zwei Möglichkeiten auf, um in Zukunft bestehen zu können: „Entweder wir reduzieren bei gleicher Leistung die Belegschaft des Betriebes um die Hälfte – oder wir verdoppeln den Umsatz des Unternehmens und sichern damit die Arbeitsplätze. Wir sind für den letzten Weg.“
Doch dieser „letzte Weg“ konnte nicht begangen werden. Zu sehr war die Chema auf den osteuropäischen Markt fokussiert, der nach 1990 fast völlig zusammenbrach. Nur etwa 3-5 Prozent des Jahresumsatzes hatte der Betrieb durch Geschäfte mit Partnern aus dem „nichtsozialistischen Wirtschaftsgebiet“ erwirtschaftet. Das Bemühen, das Unternehmen als Ganzes zu erhalten, ließ am Ende nur eine Lösung zu: die Übernahme durch die „Balcke-Dürr AG“ – eine Tochter der Deutschen Babcock. Zum 1. Januar 1991 kaufte Balcke-Dürr die „Chema Verfahrenstechnik GmbH Rudisleben“, allerdings nur in einer stark abgespeckten Variante. Bis Ende 1993 sollte die Belegschaft auf nur 800 Beschäftigte reduziert werden. Und das war nicht das Ende der Personalreduzierungen, es gab in den folgenden Jahren weitere Entlassungen, Ausgründungen und Teilverkäufe. 1996 wurde die „Schwarzfertigung“ (Ausrüstungen aus Kohlenstoffstahl) ausgelagert und an das Unternehmen Grüßing verkauft. 2000 kam dann die Auslagerung der „Weißfertigung“ (Ausrüstungen aus Edelstählen) in die neue selbstständige „Chema Prozess- und Systemtechnik“, die noch heute existiert. Und im Jahr 2000 wurde auch das prägnante Verwaltungsgebäude abgerissen. Von der „Chema Balcke – Dürr Verfahrenstechnik GmbH“ waren nur noch die Anlagenbau – und Vertriebskapazitäten übrig, die allerdings erfolgreich vor allem für Brauereien, Chemiefasern und Umwelttechnik – auch wieder auf osteuropäischen Märkten – agierten.
„2002 war allerdings auch damit Schluss“, schreibt der ehemalige Betriebsdirektor Günter Kilx in einem Manuskript über die Geschichte der Chema. „Als gegen das Mutterunternehmen Babcock Borsig AG und die Tochtergesellschaften das Insolvenzverfahren eröffnet wurde, waren alle erwirtschafteten Mittel des letzten Sprosses der Chema Rudisleben weg und damit die Existenzgrundlage auch dieser kleinen Einheit.“
Der bis zuletzt erfolgreiche Anlagenbau der Chema überlebte die Insolvenz, wenn auch in bescheidenem Umfang und unter anderem Namen. Etwa ein Dutzend der hochqualifizierten Mitarbeiter dieser Sparte wurden vom einstigen Nachauftragnehmer „EPC Engineering & Projektmanagement GmbH“ in Schwarza übernommen, es entstand eine Außenstelle dieser Firma im ehemaligen TKO-Gebäude der Chema, heute als „Solarhaus“ bekannt. EPC setzte das Anlagenbauprogramm der Chema erfolgreich fort und hat seit einigen Jahren auch seine Firmenzentrale in Arnstadt, im „Solarhaus“.
Heute befindet sich auf dem ehemaligen „Chema“-Gelände das „Gewerbegebiet Rudisleben“, Anfang 2023 gab es dort 29 Unternehmen mit insgesamt 398 Beschäftigten, zum Teil Ausgründungen und Nachfolgefirmen der ehemaligen Chema. Der größte Arbeitgeber beschäftigte 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 11 Unternehmen hatten zwischen 10 und 56 Beschäftigte, die restlichen Firmen weniger als 10. Nur die Ausdehnung des Gewerbegebiets und das „Chema“-Logo am Hauptgebäude der Chema Prozess- und Systemtechnik künden noch von der einstigen Größe des ursprünglichen Betriebs.
Nadelwerk Ichtershausen
Bis 1990 war Ichtershausen das Nadelwerk – und das Nadelwerk war Ichtershausen, fast 130 Jahre lang. 1862 hatten die beiden Jungunternehmer Wilhelm Wolff und August Knippenberg auf dem Gelände einer ehemaligen Wollspinnerei in Ichtershausen ihr gemeinsames Nadelwerk gegründet und nicht nur unternehmerisches Geschick bewiesen, sondern auch ein Gespür für neue technische Entwicklungen. So konnte die Ichtershäuser Neugründung trotz großer Konkurrenz in Deutschland und Europa rasch wachsen, zehn Jahre nach dem Start hatte die Firma bereits fast 500 Mitarbeiter. 1912 war der Betrieb mit 900 Beschäftigten schon einer der größten Nadelhersteller der Welt. Den Tod seiner beiden Gründer, zwei Weltkriege und die Weltwirtschaftskrise überstand das Ichtershäuser Nadelwerk glimpflich und nahm schon kurz nach Ende des zweiten Weltkriegs 1945 mit etwa 400 Mitarbeitern die volle Produktion wieder auf, denn Nähmaschinen- und Handarbeitsnadeln wurden ebenso gebraucht wie Reißverschlüsse.
 Später kamen weitere gefragte Produkte wie chirurgische Nadeln oder Rundstrick-Nadeln hinzu, aber auch Rouladennadeln oder Schaschlikspieße. Das Nadelwerk bekam ein eigenes Kulturhaus, einen Kindergarten im Ort und ein Ferienheim in Finsterbergen. Ein Ölheizkraftwerk wurde gebaut und wieder verworfen, weil es in der DDR mehr Rohbraunkohle als Öl gab. Das Werk wurde 1969 in das Kombinat Solidor Heiligenstadt eingegliedert und verlor dadurch seine prägnante „ICH-NADELN“-Marke, blieb aber weiter der bekannte Qualitätsbetrieb mit dem hervorragenden Ruf. 1989 beschäftigte das Unternehmen 1012 Personen und hatte 64 Auszubildende, dann kam die Wende.
Später kamen weitere gefragte Produkte wie chirurgische Nadeln oder Rundstrick-Nadeln hinzu, aber auch Rouladennadeln oder Schaschlikspieße. Das Nadelwerk bekam ein eigenes Kulturhaus, einen Kindergarten im Ort und ein Ferienheim in Finsterbergen. Ein Ölheizkraftwerk wurde gebaut und wieder verworfen, weil es in der DDR mehr Rohbraunkohle als Öl gab. Das Werk wurde 1969 in das Kombinat Solidor Heiligenstadt eingegliedert und verlor dadurch seine prägnante „ICH-NADELN“-Marke, blieb aber weiter der bekannte Qualitätsbetrieb mit dem hervorragenden Ruf. 1989 beschäftigte das Unternehmen 1012 Personen und hatte 64 Auszubildende, dann kam die Wende.

Als „Thüringische Nadel GmbH Ichtershausen“ (TNI) startete das Werk 1990 in die Marktwirtschaft – unter denkbar schlechten äußeren Bedingungen. Die Konfektionsindustrie der DDR verschwand binnen kurzer Zeit so gut wie völlig vom Markt, damit wurden keine Industrienähmaschinennadeln mehr gebraucht. Alle Handelsketten, die jetzt in den Osten kamen, brachten für Nadeln aller Art ihre eigenen Zulieferer aus dem Westen mit – und Handelspartner aus Osteuropa konnten die Waren aus Ichtershausen nicht mehr bezahlen. Der Umsatz brach schon 1990 um etwa 80 Prozent ein. „So musste schrittweise ab Juli bis Oktober 1990 für fast alle Mitarbeiter Kurzarbeit mit zehn- bis hundertprozentiger Arbeitszeitverkürzung in Anspruch genommen werden“, heißt es in der Dokumentation über das Werk.
Die Geschäftsführung unternahm in den folgenden Jahren zahlreiche Versuche, wieder am Markt Fuß zu fassen. Das Verkaufspersonal wurde aufgestockt, in Ländern wie China, Südkorea oder Australien und auch im Inland konnten neue Kunden gewonnen werden. Aber gleichzeitig sprangen auch immer wieder „Stammkunden“ ab. Die Treuhand-Anstalt stellte fast sieben Millionen DM für Investitionen zur Verfügung, erfahrene Manager aus den alten Bundesländern standen dem Unternehmen beratend zur Seite. Aber alle Bemühungen konnten die Abwärtsbewegung nicht aufhalten, immer mehr Beschäftigte mussten entlassen werden. Ende 1994 arbeiteten nur noch 220 Menschen bei TNI.
1993 gab es noch einmal einen Hoffnungsschimmer: Das Werk wurde in eine von der späteren Helaba gegründeten Beteiligungsgesellschaft übernommen. Doch „nicht vorhersehbare Verluste“ in den Jahren 1994 und 1995 führten schließlich dazu, dass das ohnehin zeitlich und finanziell begrenzte Engagement der Helaba 1996 beendet wurde. Zum 30. Juni 1996 wurde die Liquidation der „TNI Thüringische Nadel GmbH“ beschlossen. Das Nadelwerk Ichtershausen war Geschichte. Die verbliebenen 200 Beschäftigten erfuhren davon aus der Zeitung. „Die Geschichte hat uns überholt“, sagte TNI-Geschäftsführer Max H. Mayr damals gegenüber der „Arnstädter Allgemeinen“. Schon bei der Übernahme durch die Beteiligungsgesellschaft 1994 hätte das Nadelwerk „den Anschluss an den Weltmarkt verloren“ gehabt, heißt es in einem Zeitungsbeitrag von 1996, „mit veralteten und personalintensiven Technologien wurden Stückzahlen produziert, die sich im Vergleich mit den Marktführern verschwindend gering ausnahmen.“
Die Autoren einer 2011 erschienenen Dokumentation über das Nadelwerk sahen das grundsätzlich anders. Nach der Insolvenz hätten die ehemaligen Konkurrenzunternehmen aus Nordrhein-Westfalen und Bayern „die kompletten Fertigungseinrichtungen (…) einschließlich Grund- und Hilfsmaterialien sowie die Kundenkarteien erworben. Die sogenannte manufakturorientierte Fertigung in Ichtershausen schien doch interessant zu sein.“ Noch heute könnte man diese Fertigungsanlagen aus Ichtershausen in Asien, von Billig-Lohnarbeitern bedient, in Augenschein nehmen.
Die Marke „TNI“ konnte allerdings gerettet werden. In einem Nebengebäude des Nadelwerks produziert eine kleine Firma dieses Namens mit einer relativ geringen Mitarbeiterzahl chirurgische Nadeln. Es gab noch einen weiteren Versuch, die Ichtershäuser Nadeltradition fortzusetzen: Ein ehemaliger Mitarbeiter gründete 1997 in Wüllersleben die Firma „TNZ“ (Thüringer Nadelfertigung Ziggel), die Nadeln für die Elektronik, Medizintechnik und andere Bereiche herstellte und vertrieb. Die Firma wurde 2003 aus dem Handelsregister gelöscht.
Das äußere Erscheinungsbild des Nadelwerks zur Erfurter Straße hin hat sich indessen bis heute kaum verändert. 1996/97 beschloss der Ichtershäuser Gemeinderat, die Immobilie zu kaufen und zu sanieren. Die Verwaltung, die Bibliothek und ein kleines Industriemuseum zogen ein, schrittweise wurde das Gelände zur „Neuen Mitte“ Ichtershausens um- und ausgebaut. So bleibt wenigstens die Erinnerung an das Nadelwerk lebendig.
Die „Wellpappe“
Dass es auch anders ging mit der Privatisierung, zeigt das Beispiel der Arnstädter „Wellpappe“. Dort war schon im November 1989 klar, wie es in der Marktwirtschaft weitergehen sollte. Und im Wesentlichen ging es dann auch so weiter.
Kartonagen wurden in Arnstadt schon seit 1932 auf dem Gelände zwischen Ichtershäuser Straße und Mühlweg (heute Einkaufszentrum mit REWE, Aldi und einem Autohaus) produziert, ab 1948 hieß der Betrieb „Kartonfabrik Arnstadt“, später „VEB Kartonagenwerk“ und ab 1964 „VEB Wellpappenwerk“. Produziert wurden so gut wie alle Arten von Verpackungen auf Papierbasis – von der Faltschachtel bis zum Pappcontainer in Schrankgröße. Die Arnstädter Firma bewies dabei auch Erfindergeist: So erhielt sie 1972 eine Goldmedaille für eine innovative Obststiege, bei der Holz eingespart wurde und die den Transportraum besser ausnutzte. Da Verpackungen besonders im Handel mit westeuropäischen Partnern für die DDR eine immer größere Rolle spielten, gab es um 1970 die Entscheidung, in Arnstadt ein völlig neues Wellpappenwerk auf die grüne Wiese zu setzen. 1974 wurde es am heutigen Standort Ichtershäuser Straße / Bierweg eröffnet. 1977 hatte es 290 Beschäftigte.
Das neue Werk war fast ausschließlich mit moderner Technik aus dem Westen ausgestattet, um den Anforderungen für den devisenbringenden Export gerecht zu werden. Daraus ergaben sich recht enge Geschäftsbeziehungen mit Partnern aus der Bundesrepublik, die der Firma zur Wende zugutekommen sollten.
Und so fand schon wenige Tage, nachdem die Mauer fiel, ein denkwürdiges Geheimtreffen statt. Ende November 1989 wurde die Führungsriege der „Wellpappe“ zu einem Abendessen ins Arnstädter Bahnhofshotel eingeladen. Dort saß der Unternehmer Gustav Stabernack aus dem hessischen Fulda mit einem kleinen Mitarbeiterstab und verkündete seine Absicht, im Falle der Wiedervereinigung das Arnstädter Werk übernehmen zu wollen, das er aus der Zusammenarbeit schon bestens kannte. Und Stabernack stand zu seinem Wort.
Ab Januar 1990 wurden erste Mitarbeiter aus Arnstadt in Fulda ausgebildet, es entwickelte sich eine rege Besuchstätigkeit, obwohl erst am 19. Juli 1990 der offizielle Verkaufsakt vollzogen wurde: Die „Verpackungsgruppe Stabernack JR Partner GmbH“ übernahm die „Arnstadt Verpackung GmbH“ von der Treuhandanstalt. Der Arnstädter Betrieb behielt weitgehend seine Selbstständigkeit, 260 der bisher 480 Beschäftigten wurden übernommen, für die Ausscheidenden gab es großzügige Abfindungen.
Schon in den ersten Jahren wurden 40 Millionen D-Mark in die Firma investiert, ab 1995 schrieb sie schwarze Zahlen. Durch die Verbindungen über den hessischen Mutterbetrieb war auch die Auftragslage stabil. Zwölf Jahre nach der Privatisierung gab es allerdings für die Arnstädter Wellpappe schon wieder einen Einschnitt: Gustav Stabernack verkaufte seine Firmen 2002 an die schwedische Gruppe SCA Packaging. Und zehn Jahre später gab es schon wieder einen Besitzerwechsel.
Nun wurde in Arnstadt die britische Fahne gehisst, der neue Eigentümer war der Verpackungsriese DS Smith. Doch beide Übergänge verliefen recht reibungslos, schon unter SCA wurde weiter investiert und ausgebaut, der immer größere Anteil des Versandhandels brachte auch einen enormen Aufschwung für die Verpackungsindustrie. Diese Entwicklung setzte sich unter DS Smith fort, auch der Brexit hatte offenbar keine negativen Auswirkungen für das Arnstädter Werk. DS Smith gab Ende 2022 bekannt, fast 20 Millionen Euro für eine neue Wellpappenerzeugungsanlage (WPA) und ein Hochregallager, das so hoch wie die Arnstädter Wohnscheibe ist, ausgegeben werden.
„Qualität von Weltruf“: das Fernmeldewerk
Wie auch die „Chema“ wurde das Arnstädter Werk von Siemens & Halske 1937 als Rüstungsbetrieb konzipiert. Nicht offiziell, da wurden Rundfunkgeräte und Zubehörteile hergestellt. Aber im Kriegsfall sollte die Produktion schnell auf elektrische Teile für Bombenzünder und militärische Nachrichtentechnik umgestellt werden. Und so wurde 1938 das so genannte „Wernerwerk“ am Bierweg in Betrieb genommen. Architektonisch im (eigentlich von den Nazis verhassten) Bauhaus-Stil gehalten, aber mit Tarnfarben-Putz für den „Ernstfall“. Der trat schon ein Jahr später ein. Bis zu 3200 Menschen produzierten nun hauptsächlich Rüstungstechnik, in den letzten Kriegsjahren kamen immer mehr Zwangsarbeiter aus ganz Europa dazu. (Mehr über Zwangsarbeiter in Arnstädter Betrieben gibt es hier.)
Nach dem Krieg wurden zunächst viele Produktionsmittel und Unterlagen von den Amerikanern abtransportiert, dann kamen die Russen und sorgten dafür, dass die Produktion von Rundfunkgeräten wieder anlief. Es gab sogar ein Geheimprojekt zur Entwicklung von Fernsehgeräten, das eigentlich nach alliiertem Recht verboten war und nach zwei Jahren erfolgreicher Entwicklung nach Leningrad verlegt wurde. Über einige Zwischenschritte kam es dann 1951 zur Umbenennung in „VEB Fernmeldewerk Arnstadt“. So hieß der Betrieb, lässt man Kombinatszugehörigkeiten weg, bis zur Wende. Die Arnstädter sagten allerdings nur „RFT“, denn so stand es auch in großen Leuchtbuchstaben auf dem Dach des 1963 eröffneten Verwaltungsgebäudes: „RFT – Qualität von Weltruf“. Das Kürzel stand für „Rundfunk- und Fernmeldetechnik“, einem Herstellerverbund, zu dem auch das Arnstädter Werk gehörte.

Hergestellt wurde Fernmeldetechnik. Keine Telefone, sondern Vermittlungsanlagen, die auf den Ämtern der Post die Verbindungen zwischen den Teilnehmern herstellten. Dazu wurden Relais, Drehwähler, Hebdrehwähler und später auch Koordinatenschalter in riesigen Schaltschränken montiert und über Kabelbäume miteinander verbunden. Der Bedarf an solchen Anlagen war groß, nicht nur in der DDR. Hauptabnehmer war deshalb auch nicht die Deutsche Post, sondern bis zu 85 Prozent der Produktion gingen in den Export. Vor allem in die Sowjetunion und die anderen Länder des „RGW“, aber die Anlagen wurden auch nach Griechenland, Kuwait, die Türkei, Vietnam und Mexiko verkauft. Die Technik änderte sich mit der Zeit, aber Vermittlungsanlagen blieben das Hauptgeschäft des Fernmeldewerks. Dazu kamen – wie bei allen VEB – „Konsumgüter“. Im Falle des Arnstädter Betriebs waren das zum Beispiel Kugel-Lautsprecherboxen und Kassettengeräte für das Auto.
Das Werk wuchs schnell, 1962 waren dort 1300 Arbeitskräfte beschäftigt, drei Jahre später waren es bereits 3000. Es gab ein RFT-Kulturhaus in der Lindenallee mit zahlreichen Arbeitsgemeinschaften, ein Betriebsferienheim bei Jena, ein Kinderferienlager in Siegelbach einen Kindergarten und eine Kinderkrippe. In der eigenen Berufsschule in der Plaueschen Straße wurden jährlich bis zu 360 Lehrlinge sowohl theoretisch als auch praktisch ausgebildet. Zur Wende war das Fernmeldewerk mit 3000 Beschäftigten, darunter 100 vietnamesische Vertragsarbeiter, mit Abstand der größte Betrieb in Arnstadt und Umgebung.
Mit 3000 Beschäftigten 1990 in die Marktwirtschaft zu starten, war eine schwere Aufgabe: Dazu brauchte man einen starken Partner. Das „RFT“ sondierte in verschiedene Richtungen, dann wurde relativ schnell ein Joint Venture mit „Standard Elektrik Lorenz“ in Stuttgart-Zuffenhausen abgeschlossen, einem ehemals sehr erfolgreichen Produzenten von Unterhaltungselektronik, der sich nun in französischem Besitz befand (Alcatel) und sich hauptsächlich mit Nachrichtentechnik beschäftigte. Das Unternehmen hieß zunächst ab 1. Juli 1990 „RFT-SEL GmbH“, weil das RFT mit 51 Prozent die Mehrheit besaß. Schnell wurde aber klar: Um das Werk für die Zukunft fit zu machen, wird viel Geld gebraucht. Und Geld hat nur SEL. Also wurde aus RFT-SEL nun SEL-RFT.
Für Vermittlungstechnik gab es anfangs gute Marktaussichten: Allein auf DDR-Gebiet bestand ein großer Bedarf an modernen, digitalen Anlagen. Die neue Generation hieß „Alcatel S 12“ und kam nun auch aus Arnstadt. Die Anlagen und Hallen wurden umfassend saniert, viele Beschäftigte umgeschult. Und SEL-RFT begann um 1995, auch sein zweites Standbein in Arnstadt zu etablieren: Eisenbahn-Signaltechnik. Ein darauf spezialisierter Betrieb in Berlin wurde geschlossen, die Produktion samt modernem Hochregallager zog zwischen 1993 und 1995 nach Arnstadt um. Gleichzeitig verschwand das „RFT“ aus dem Firmennamen, zwei Jahre später auch das „SEL“. Das Werk firmierte ab 1997 nur noch unter dem Namen der Muttergesellschaft Alcatel.
Doch die hochgesteckten Expansionspläne der Firma gingen nicht auf. Besonders bei der Vermittlungstechnik gab es zunehmend Absatzprobleme, die nur zum Teil auf Mängel im eigenen Produkt zurückzuführen waren, insgesamt ging der Bedarf an Festnetz-Vermittlungsanlagen wegen der aufkommenden Funknetze zurück. Alcatel geriet in schwere Turbulenzen, musste viele Beschäftigte entlassen und ganze Standorte schließen. Eigentlich wurde der Arnstädter Betrieb dabei bevorzugt behandelt: Während andere Werke in Rochlitz, Berlin oder Landshut dichtgemacht oder verkauft wurden, wanderte deren Produktion samt Produktionsmitteln nach Arnstadt. Doch die Entwicklung der Beschäftigtenzahlen war auch hier keinesfalls rosig: Jährlich wurden von den einstmals 3000 Beschäftigten etwa 300 entlassen, in Auffanggesellschaften untergebracht oder umgeschult. Nach außen wurde diese Entwicklung durch eine Umnutzung sichtbar: Aus dem ehemaligen Bürogebäude am Bierweg wurde das Arnstädter Arbeitsamt (ab 2004 Agentur für Arbeit).
Mit einer immer kleiner werdenden Belegschaft versuchte die Werkleitung, die auch in den 90-er Jahren überwiegend aus „Einheimischen“ bestand, die richtigen strategischen Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Eine dieser Grundentscheidungen war: Die Bahn-Signaltechnik, das zweite, erst nach der Wende hinzugekommene Standbein, sollte künftig das Profil des Werkes bestimmen. Und so wurde Ende 1999 die Produktion von Telefon-Vermittlungstechnik ganz eingestellt, das Herzstück des einstigen Fernmeldewerks. Damit war das „RFT“ wirklich Geschichte.
Die Entscheidung stieß damals teilweise auf Unverständnis, war aber aus heutiger Sicht wohl die einzig richtige: Mit Vermittlungstechnik für Festnetzanschlüsse wäre die Zukunft nicht zu gestalten gewesen. Und der große Bedarf an Bahn-Signaltechnik und die gute Qualität aus Arnstadt sichern heute etwa 500 Arbeitsplätze auf dem ehemaligen „RFT“-Gelände bei der Firma, die heute „Thales“ heißt.
Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in der Region
Aus der Geschichte der vier in diesem Beitrag behandelten Betriebe kann man nicht auf die gesamte Wirtschaft der Region schließen. Wie die Lage nach der Wende war, lässt sich aber aus einer Information ableiten, die im Juli 1991 im Arnstädter Kreistag zur Situation der Betriebe im Kreis gegeben wurde. Dort sagte die für Wirtschaft zuständige Amtsleiterin Gisela Dornbusch: „Nur drei Betriebe [im Kreis Arnstadt, d. A.] können als gesund bezeichnet werden: Möbelwerk Arnstadt, Saline Oberilm und Sägewerk Crawinkel“.
Die Arbeitslosenquoten jener Jahre spiegeln das tatsächliche Problem des Verlustes vieler Arbeitsplätze nur bedingt wider. Das liegt zum einen an der mangelnden Vergleichbarkeit der Zahlenreihen, Mitte der 90-er Jahre gab es Veränderungen in der Kreisstruktur und der Zuständigkeit der Arbeitsamtsbereiche. Zum anderen wurden Werktätige, die keine Arbeit mehr hatten, meist nicht direkt in die Arbeitslosigkeit entlassen. Sie gingen zunächst in Kurzarbeit, was auch „Kurzarbeit Null“ bedeuten konnte. Eine weitere Möglichkeit, den direkten Abstieg in die Arbeitslosigkeit hinauszuzögern, waren „Auffanggesellschaften“. Dort wurden Menschen zeitlich begrenzt weiterbeschäftigt, etwa mit Aufräum- und Demontagearbeiten ihrer abgewickelten Betriebe oder Betriebsteile. Daneben gab es noch das System der ABM (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen), Qualifizierungen und Umschulungen.
Die Entwicklung der Arbeitslosenquoten und -zahlen im Arbeitsamtsbezirk Arnstadt gibt also über die Lage auf dem Arbeitsmarkt nicht vollständig Auskunft, zeigt aber die Tendenz ziemlich gut auf. Die Quoten sind der monatlichen Berichterstattung der „Thüringer Allgemeine“ und ab 1994 den Berichten des Thüringer Landesamts für Statistik entnommen.
In den ersten beiden Jahren nach der Wiedervereinigung werden aus Arnstadt noch recht moderate Arbeitslosenquoten unter 10 Prozent gemeldet, Spitzenreiter war 1990 Sondershausen (Kalibergbau). Im Februar 1992 schnellte die Arnstädter Quote auf 18,7 Prozent, war aber im Regionalvergleich trotzdem vergleichsweise niedrig: Der Nachbarkreis Ilmenau lag durch das Aus für die Großbetriebe für Glas und Keramik bei 26 Prozent, sechzehn Landkreise registrierten über 20 Prozent.
Im Januar 1994 gab es in Arnstadt eine deutliche Steigerung auf 22,5 Prozent, laut Landesamt für Statistik waren 6257 Menschen im Arbeitsamtsbezirk Arnstadt arbeitslos. Und im November 1994 erklomm Arnstadt dann erstmals die traurige Spitze in der Thüringer Arbeitslosenstatistik: „Besonders dramatisch stellt sich die Situation im früheren Kreis Arnstadt dar, der jetzt erstmalig die höchste Arbeitslosigkeit in Thüringen vermelden musste“, schrieb die „Thüringer Allgemeine“. Ein Jahr lang nahm Arnstadt diesen Spitzenplatz ein. Danach blieb zwar die Arnstädter Arbeitslosigkeit weiter auf hohem Niveau, die Spitze übernahmen aber andere – zum Beispiel Altenburg und Artern.
Die Stagnation setzte sich im Rest des Jahrzehnts fort. Zwar bestimmten andere Orte wie Bischofferode die Schlagzeilen, aber die Arnstädter Zahlen blieben schlecht. Im Dezember 2000 lag die Arbeitslosenquote im Bereich Arnstadt noch immer bei 19,3 Prozent. 5598 Menschen, die noch zehn Jahre vorher mit einer sicheren beruflichen Perspektive gerechnet hatten, standen auf der Straße. Mehrere Tausend, die sich in Kurzarbeit, ABM oder Umschulung befanden, nicht mitgerechnet.
In den frühen 90-er Jahren befanden sich in der Region zeitgleich etwa 1000 Menschen in ABM und 1100 in Qualifizierungen und Umschulungen. In der Metallbranche gab es die meisten Entlassungen, in diesem Sektor wurden aber kaum Arbeitsplätze angeboten. Bedarf bestand vor allem im Baugewerbe, denn für Wohnungsneubau und die Sanierung des Altbestands wurden Arbeitskräfte gesucht. Also setzte das Arbeitsamt dort den Schwerpunkt in der gewerblichen Qualifizierung. Der Bedarf in diesem Bereich hielt allerdings nur wenige Jahre an.
In Arnstadt gab es anfangs nur sehr wenige Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Als die Lokalredaktion Arnstadt der „Thüringer Allgemeine“ im September 1990 den Bürgermeister nach ABM-Ideen fragte, antwortete der damalige Amtsinhaber Helmut Hüttner: „Drei Bürger sollen für das Marktgeschehen als Marktmeister, dessen Gehilfe und für die Reinigung des Marktes eingestellt werden. Für die Pflege der Grünanlagen sind fünf Personen vorgesehen“. Mehr Vorschläge gab es von der Stadtverwaltung noch nicht. Lediglich die heute eingemeindeten Dörfer Siegelbach, Espenfeld und Dosdorf beschäftigten über einen längeren Zeitraum 36 Frauen zur erfolgreichen Dorfsanierung.
Auch später waren es in Arnstadt vor allem Vereine, Kulturträger oder ehrenamtlich tätige soziale Institutionen, die Arbeitsmöglichkeiten für ABM-Kräfte schufen. So wurde unter Regie des Neideckvereins die Ruine des Schlosses ausgegraben, gesichert und mit Infrastruktur wie Toiletten und Sitzungsraum versehen. Alle Modelle, die bis vor kurzem noch auf dem Gelände zu sehen waren, wurden von ABM-Kräften gefertigt, auch das mittelalterliche Stadtmodell Arnstadts im Gärtnerhäuschen. Im Tierpark Fasanerie, im Jonastalverein und an vielen anderen Stellen erledigten ABM-Kräfte mit viel Geschick und Engagement Arbeiten, für die sonst kein Geld oder kein Personal da war. Die Lohn- und einen großen Teil der Sachkosten übernahm das Arbeitsamt. Dadurch fielen die offiziellen Arbeitslosenzahlen deutlich niedriger aus, in manchen Monaten wie dem Mai 1998 wurden über 200 Arbeitslose in ABM-Stellen „vermittelt“. Eine echte Perspektive für die Betroffenen boten diese Stellen aber nur in wenigen Fällen.
Kollateralschäden
Die allgemein schlechte wirtschaftliche Lage der Unternehmen schlug sich auch auf ihre Ausbildungsbereitschaft nieder, sie ging gegen Null. Schon im Juli 1991 war RFT SEL der einzige Betrieb überhaupt, der in Arnstadt noch eine betriebliche Ausbildung anbot, berichtete die „Thüringer Allgemeine“. So, wie sich viele Erwachsene in den alten Bundesländern nach einem neuen Job umsehen mussten, erging es auch den Jugendlichen: Nur in der Ferne boten sich gute Ausbildungsmöglichkeiten. Ein Problem, mit dem heute die Firmen auf der Suche nach Fachkräften kämpfen. Viele, die damals weggingen, kamen nicht wieder zurück.
Die Zahl der Pendler und „Auswanderer“ nahm in den 90-er Jahren rasch zu, die Arnstädter Bevölkerung demzufolge ab – zumal nach der Wende auch die Geburtenzahlen einbrachen. Weil es durch die Situation der Betriebe nur wenig Gewerbesteuereinnahmen gab, war die finanzielle Situation der Stadt Arnstadt fast durchgehend angespannt.
Auf das kulturelle Leben hatte vor allem der Verlust der großen Werke RFT und Chema wesentliche Auswirkungen. Beide hatten große Kulturhäuser in der Stadt betrieben, in denen regelmäßig Tanz- und Konzertveranstaltungen stattgefunden hatten. Aber sie waren zugleich auch Träger zahlreicher Kulturgruppen und Zirkel. Das „Chema-Ensemble“ war weit über die Kreisgrenzen bekannt, viele Arnstädter verbrachten hier oder im RFT-Kulturhaus regelmäßig ihre Freizeit. Als die Chema 1990 privatisiert wurde, fiel das Kulturhaus in der Lindenallee an die Treuhand, die es 1991 an die früheren Eigentümer zurückgab. Schon bald wurde es abgerissen und durch ein Wohnhaus ersetzt.
Das RFT-Kulturhaus ging zunächst in kommunalen Besitz über und wurde mit Unterstützung des „Lindeneckvereins“ betrieben, der zeitweilig über 300 Mitglieder hatte. Der Verein stellte auch ABM-Kräfte ein, die mit für Ordnung und den Erhalt der Substanz sorgten. In dieser Zeit fanden regelmäßig Tanz- und andere Veranstaltungen statt. Eine nötige gründliche Sanierung konnte sich die Stadt Arnstadt allerdings nicht leisten und verkaufte das Kulturhaus an einen privaten Betreiber. So wurde zwar einige Jahre noch weiter getanzt, aber gründlich saniert wurde nicht.
Also fiel das Haus schließlich auch der Abrissbirne zum Opfer. Aus den früheren Kulturgruppen bildeten sich zum Teil Vereine, die bis heute bestehen. Aber das war ein längerer Prozess, die Lücke, die das Verschwinden der betrieblichen Kulturhäuser hinterlassen hatte, unübersehbar.
Wie ging es weiter?
Die Gemeinden Ichtershausen und Arnstadt reagierten sehr unterschiedlich auf die neuen wirtschaftlichen Herausforderungen. Ichtershausen schuf sich schon frühzeitig die bessere Startposition. Im Mai 1990 wurde der Nadelwerker Klaus von der Krone zum Bürgermeister von Ichtershausen gewählt, schon wenige Monate später, im September 1990, fiel im Gemeinderat die Entscheidung zur Planung und Erschließung des „Gewerbeparks Ichtershausen – Thörey – Autobahn“ (GITA) auf einer Fläche von 92 Hektar. Im Juni 1992 war dafür erster Spatenstich. Zu einer Zeit, wo das Aus für das Nadelwerk keinesfalls absehbar war, setzte Ichtershausen schon auf die Ansiedlung neuer Industriebetriebe. Mit dem Türenhersteller „Garant“ kam der erste bereits 1992, später folgten „Hörmann“ und andere.
Zu dieser Zeit tat sich Arnstadt noch sehr schwer mit der Schaffung neuer Arbeitsmöglichkeiten. Zwar wurde gegenüber des „Chema“-Geländes ein neues Gewerbegebiet ausgewiesen, aber dort bauten hauptsächlich Autohäuser. Der wirtschaftliche Aufschwung für Arnstadt setzte erst mit der Ausweisung des Gewerbegebietes „Erfurter Kreuz“ ab 2001 ein. Zwar befindet sich dieses größte Gewerbegebiet Thüringens nur zum Teil auf Arnstädter Territorium (der andere Teil gehört zu Ichtershausen / Amt Wachsenburg), aber mit der Ansiedlung des Autozulieferers Borg Warner 2003 und des Triebwerksspezialisten N3 im Jahr 2005 im Arnstädter Teil begann der wirtschaftliche Aufschwung. Immer mehr Firmen ließen sich dort nieder. Auch die Krise der Photovoltaik-Produzenten überstand das Erfurter Kreuz glimpflich, alle damals entstandenen Gebäude werden wieder nachgenutzt, nichts wurde abgerissen.
Ende 2022 arbeiteten am Erfurter Kreuz und in den anderen nach der Wende geschaffenen Gewerbegebieten von Arnstadt und dem Amt Wachsenburg ungefähr 8500 Menschen, die Zahl wird ständig größer, weil derzeit Werke wie CATL, N3, Borg Warner oder Marquardt neue Arbeitskräfte einstellen – wenn sie welche finden.
Die Region Arnstadt kann heute mit der wirtschaftlichen Entwicklung zufrieden sein. Aber man darf darüber nicht vergessen, dass es nach der Wende lange Jahre gab, in denen es anders war, in denen für tausende Menschen die Gegenwart verschwand. Nur wenn man sich daran erinnert, kann man die Gegenwart verstehen.
Ich danke Ulrich Hoder, Andrea Kirchschlager, Ernst Kühn, Martina Lang, Jörg Neumann, Albrecht Pein, Holger Poppenhäger und Uwe Schnärz herzlich für die Unterstützung bei den Recherchen zu diesem Beitrag.
Die Angaben zu den Betrieben stammen zum Teil aus der Chronik von Arnstadt. Zeittafel/Lexikon. Arnstadt 2003. Die Informationen zum Nadelwerk (einschl. Fotos) sind der Materialsammlung „Nadelwerk Ichtershausen – aus der Geschichte einer traditionsreichen Produktionsstätte“, 2011 herausgegeben von der Gemeindeverwaltung Ichtershausen, entnommen.
Siehe auch:
Die Privatisierung der Gelenkwelle