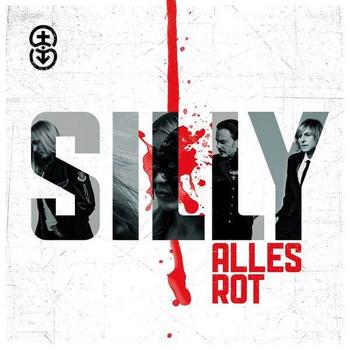Der Schnee dieser Woche machte es fast vergessen: Es ist noch immer Herbst. Mit Nebel, Mistwetter und mürrischen Gesichtern auf den Straßen. Eigentlich schade, dass er bald vorbei ist.
Der Schnee dieser Woche machte es fast vergessen: Es ist noch immer Herbst. Mit Nebel, Mistwetter und mürrischen Gesichtern auf den Straßen. Eigentlich schade, dass er bald vorbei ist.
Wenn es neblig ist, kann man sich endlich einmal ungestraft schlecht fühlen. Ohne dass sofort einer fragt, warum man solch eine Laune hat. Und falls doch, sagt man einfach: Das Wetter. Und jeder noch so lästige Zeitgenosse nickt plötzlich ganz verständnisvoll: Du mich auch.
Der Herbst ist eine geniale Jahreszeit, weil das Animationsprogramm des sonst so durchorganisierten Event-Aufenthaltes auf Erden Pause macht. Man muss nicht gebräunt aussehen. Man kann sogar Hüftspeck haben und sich trotzdem gut fühlen, weil die T-Shirt-Pflicht aufgehoben ist. Man kann mürrisch dreinschauen – und niemand nimmt daran Anstoß. Im Gegenteil: Der aufmerksame Beobachter wird feststellen, wie glücklich all die schniefenden, mürrischen, maulfaulen Mitmenschen in Wirklichkeit sind. Denn sie brauchen sich nicht zu verstellen.
Der Mensch ist so. Den Zustand permanenten Glücks und vollendeter Harmonie, den die Werbung ihm als Ideal vorgaukelt, hält er höchstens eine Woche lang am Stück aus. Spätestens dann fordert ein Menschenrecht seinen Tribut, das nicht mehr länger geleugnet werden darf: Das Recht auf eine gesunde Depression. Sicher, das ist eine unbequeme Wahrheit. Doch sie hält der Überprüfung am Alltags-Verhalten des Homo Sapiens stand. Wozu bräuchte die Menschheit Fernsehsendungen wie Casting- oder Talkshows, wenn es nicht einen natürlichen Hang des Zuschauers zur Depression gäbe? Und warum rennen so viele zu furchtbar schlechten Fußballspielen? Oder warum ertragen erwachsene Menschen, selbst wenn sie etwas Ordentliches gelernt haben, geduldig und mit entrückter Miene das Inferno einer Stadtrats- oder Kreistagssitzung?
Es ist gut, dass es die kleine Depression zwischendurch gibt. So wie Alkohol, Heino oder der kommunale Finanzausgleich auch nicht immer und für jeden etwas Schlechtes sind. Natürlich gibt es Grenzen: Wenn man zu viel davon hat, sollte man seinen Arzt oder Apotheker zu Rate ziehen. Aber der Rest der Menschheit darf sich weiter allsommerlich auf den Herbst freuen. Wenn es auch innerlich so schön trübe wird.
 Heute mal was wirklich Gutes über unseren Berufsstand gelesen. Zeit-Online-Chef Blau liest uns Journalisten in der Süddeutschen ordentlich die Leviten.
Heute mal was wirklich Gutes über unseren Berufsstand gelesen. Zeit-Online-Chef Blau liest uns Journalisten in der Süddeutschen ordentlich die Leviten.